Das Schwirren eines Vogels auf Blütenblättern, der Aufprall einer Nippesfigur auf dem Fußboden
Erstens: Jodie Foster.
 Jodie Foster ist eine einschüchternd kluge Frau. Männer pflegen ja von solchen Fabelwesen impotent zu werden, wofür sie sich dann eine Beziehung lang rechtfertigen müssen. Nur Jodie Foster macht das mit Absicht.
Jodie Foster ist eine einschüchternd kluge Frau. Männer pflegen ja von solchen Fabelwesen impotent zu werden, wofür sie sich dann eine Beziehung lang rechtfertigen müssen. Nur Jodie Foster macht das mit Absicht.
In Panic Room (2002) tat sie so, als ob sie gedemütigt werde. Dabei rächte sie sich nur für die Demütigungen, die sie seinerzeit in ihren Lolitafilmen erleben musste. Oder soll das Zufall sein, dass sie eine Filmtochter vorschieben durfte, so alt wie Jodie Foster in Taxi Driver? Dann lesen Sie das dicke Buch der kalifornischen Mythologie nochmal.
Aufs Blut gereizte Bärenmama mit Bärentochter in Bärenhöhle (muss ich wirklich beweisen, dass wir hier in eine Gebärmutter eindringen?) bewirft geldgierige, schwanzgesteuerte Eindringlinge mit Eisenträgern; verspielte, noch nicht ganz herangereifte Bärentochter tapst nach alter Lolitasitte barfuß Bärenmama hinterher, die anscheinend seit ihrer eigenen Lolitazeit nur ihre Schuhe noch nicht wiedergefunden hat, und muss für leinwandfüllende Großaufnahmen ihre geschundenen Rosenfüßchen in die Kamera halten, ja wird geradezu über die verkrampfte Mimik ihrer Zehen als das verletzlichste aller Päderastenopfer charakterisiert – mit solchen topoi hat das Hollywood des jungen Jahrtausends doch nicht für die Katz den Panic Room möbliert. Sonst sind sie ja auch eher auf fadenscheinig sublimierte Übermütter mit Bombenbrüsten fixiert.
Da sei Jodie Foster vor. Als sie vor Jahrzehnten in ihrer Rolle als Mädchen am Ende der Straße allein in eine Art Panic Room eingesperrt war, wurde sie schon mal von nicht ganz so entschlossenen Unholden behelligt. Barfuß wie ein Bärenjunges, um den Anschein der Selbstbestimmtheit (und ihren zweiten Oscar) ringend, aber letztendlich schutzlos wie in Humbert Humberts Motelzimmer. Und was las sie dort? Emily Dickinson.
Zweitens: Emily Dickinson.
 Emily Dickinson war eine einschüchternd kluge Frau. Das hat nur niemand gemerkt, weil sie praktisch ihr Leben lang ihren Panic Room, nein falsch: ihr Kinderzimmer nicht verließ. Was sie dort statt dessen trieb, weiß Heinz Schlaffer in der Süddeutschen Zeitung vom 18. November 2006:
Emily Dickinson war eine einschüchternd kluge Frau. Das hat nur niemand gemerkt, weil sie praktisch ihr Leben lang ihren Panic Room, nein falsch: ihr Kinderzimmer nicht verließ. Was sie dort statt dessen trieb, weiß Heinz Schlaffer in der Süddeutschen Zeitung vom 18. November 2006:
Selten verließ sie den Wohnort, bald immer seltener Haus und Garten ihres Vaters, am Ende kaum noch ihr Zimmer. Enthusiastisch liebte sie ihre Verwandten und Freundinnen, blieb dabei aber unzugänglich. Später sprach sie mit ihnen nur durch die halb geöffnete Tür aus dem Zimmer, das die anderen nicht betreten durften. Hier lebte sie mit ihren Gedichten für sich. […]
Es trifft sich gut, dass in diesem Herbst gleichzeitig eine Ausgabe ihrer Gedichte und eine Auswahl ihrer Briefe erschienen sind. So wird sichtbar, dass sich ihre Gedichte wie Briefe, ihre Briefe wie Gedichte lesen. Auch die Briefe verzichten auf Nachrichten über Umstände, Fakten und auf eine zusammenhängende Darstellung von Situation und Ereignis. Beide, Gedicht und Brief, wirken wie überstürzte Mitteilungen zufälliger Notizen, wobei einige wie von selbst zu Reim und Rhythmus finden und dann Gedicht heißen.
Eine also, der kein anderes Ausdrucksmittel zu Gebote stand als die lyrische Gestaltung. Eine so durchschaubare wie begreifliche Form des Selbstschutzes. Dass sie sich auch noch als Barfuß-Dichterin empfand, betont in diesem Fall wohl ihre Verletzlichkeit. Sowas lesen dann die bedrohten Mädchenexistenzen in ihren Jungfrauenzimmern.
Drittens: Herman Melville.
Herman Melville war ein einschüchternd kluger Mann. Was aber niemanden jemals groß interessierte, am wenigsten seine Frau. – In Heinz Schlaffers o.a. luzider Besprechung kommt auch kurz Melville vor:
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht eine autonome amerikanische Literatur, sogleich aber von höchstem Rang: in den Essays Emersons, den Romanen Hawthornes und Melvilles, in der Lyrik Walt Whitmans und Emily Dickinsons. Doch selbst diese Gedichte, so fern sie auch allem praktischen Nutzen zu stehen scheinen, sind dem Geist der Pioniere, die einen Kontinent erobern, verwandt: Sie erkennen keine Konventionen der lyrischen Sprache an; sie wollen nur sagen, was wirklich und wahr ist. Deshalb sind sie rücksichtslos neu. Aus der adamitischen Situation der amerikanischen Kultur, die noch einmal am Anfang der Schöpfung zu stehen glaubt, geht ein eigenständiger Beitrag zur Literatur der Moderne hervor. Die amerikanische Lyrik verabschiedet, wie die europäische seit Rimbaud, die Vorstellung von schönen Versen, um die archaischen Elemente der Poesie wieder freizulegen.
 So führt ein direkter Weg von Melvilles Ishmael und den Lost Boys auf der Pequod über Emily Dicksinsons autistische Lyrik und Nabokovs Lolita, die mit Humbert Humbert die USA bereiste, bis zu den populärpostfeministischen Jodie-Foster-Schinken.
So führt ein direkter Weg von Melvilles Ishmael und den Lost Boys auf der Pequod über Emily Dicksinsons autistische Lyrik und Nabokovs Lolita, die mit Humbert Humbert die USA bereiste, bis zu den populärpostfeministischen Jodie-Foster-Schinken.
Alle eine Revolution, alle eine Revolte.
Gibt es überhaupt künstlerisches Schaffen, das keine Kindheitsneurosen aufarbeiten will?
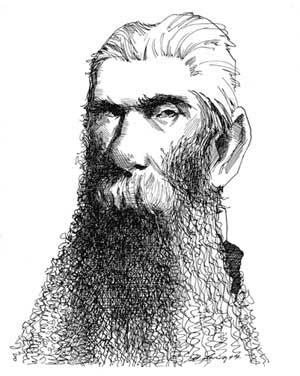






[…] zu Das Schwirren eines Vogels auf Blütenblättern, der Aufprall einer Nippesfigur auf dem Fußboden: Wir scheinen eine ganze Menge über Konzentrationsspannen zu wissen, jene Bestandteile des […]
Cats in the Cradle and the Silver Spoon, Little Boy Blue and the Aufmerksamkeitsspanne « Moby-Dick™
21. February 2011 at 8:32 am